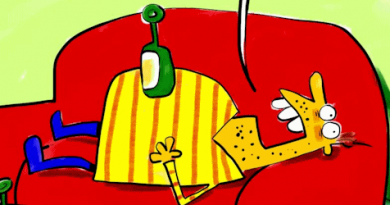Die, die das Licht riecht
 Der warme Spätnachmittag war wie ein Heuhaufen voller Belanglosigkeiten. Juli Zeh zog die Haustür hinter sich zu und trat auf den schmalen Gehsteig, der vor ihrem Haus vorbeiführte. Sie wandte sich in Richtung Dorfzentrum. Sie atmete tief ein. Die Vögel zwitscherten. Irgendwo krähte ein Hund. Irgendwo bellte ein Hahn. Plötzlich war es, als sei sie eine Figur in einem Roman.
Der warme Spätnachmittag war wie ein Heuhaufen voller Belanglosigkeiten. Juli Zeh zog die Haustür hinter sich zu und trat auf den schmalen Gehsteig, der vor ihrem Haus vorbeiführte. Sie wandte sich in Richtung Dorfzentrum. Sie atmete tief ein. Die Vögel zwitscherten. Irgendwo krähte ein Hund. Irgendwo bellte ein Hahn. Plötzlich war es, als sei sie eine Figur in einem Roman.
Wie eine Romanfigur hatte sie sich als Kind oft gesehen. Tief in ihr lebte dieses Kind noch, und so konnte es auch heute noch geschehen, dass sich die eigentlich erwachsene Schriftstellerin in fremde Welten flüchtete. Besonders häufig war dies während der Zeit der Entstehung ihres Erfolgsromans »Unterleuten« geschehen. Auf ihrer Homepage hatte sie gestanden: »Es konnte vorkommen, dass ich meinen Mann gefragt habe: ›Sag mal, wie geht es eigentlich Linda, ich habe schon so lange nichts mehr von ihr gehört?‹ – Und dann wurde mir erst klar, dass Linda eine Figur aus ›Unterleuten‹ ist und dass es sie gar nicht in Wirklichkeit gibt, nur in meinem Kopf.«
Deswegen einen Arzt aufzusuchen kam für Juli Zeh nicht in Frage. Sie bereute diese Entscheidung auch nicht, egal wie schablonenhaft die Welt um sie herum in diesen romanartigen Momenten wirkte, egal, wie stereotyp sich die Leute plötzlich verhielten und wie vorhersehbar die Geschehnisse waren.
Als sie den Feldweg zum Dorfanger entlang lief, wurde das Gefühl, wortwörtlich in einem ihrer eigenen Romane zu sein, stärker. Der Wald wies sie ab, als wollte er nichts mit ihr zu tun haben. Die Blätter der Pappel zitterten silbrig. Der Wind roch nach abkühlenden Sonnenstrahlen. Der Garten stand reglos, als wäre der Wind noch nicht erfunden. Ja, tatsächlich: als wäre der Wind noch nicht erfunden! So reglos! Reglos, als wäre der Wind noch nicht erfunden. Dabei war der Wind doch schon längst erfunden – von Leonardo da Vinci vermutlich und von Thomas Edison zur Perfektion gebracht. Ach, käme doch nur einer und schaltete den Wind ein, dachte sie und blickte zurück in den Garten, der weiterhin so reglos stand, als wäre der Wind noch nicht erfunden.
In ihrer Hosentasche ertastete sie das Bundesverdienstkreuz, das sie vor Kurzem erhalten hatte. Sie trug es selten offen um den Hals. Meistens nur beim Einkaufen oder beim Spazierengehen mit den Hunden. Manchmal auch, wenn sie die Kinder von der Schule abholte, beim Friseur oder wenn sie sich gegen gutes Geld von einem der ortsansässigen Bauern auf einem geschmückten Anhänger und in Begleitung der Musikkapelle durchs Dorf fahren ließ. Sonst aber ließ sie es manchmal einfach in ihrer Hosentasche.
Sie wollte nicht allen anderen permanent unter die Nase reiben, dass ihre Staatstreue nun amtlich war. Auf den Orden verzichten wollte sie allerdings auch nicht. Er spendete ihr Kraft wie ein großer Teller Nudeln im Magen eines Profischwimmers.
Und es war auch gut zu wissen, dass der Bundespräsident hinter einem stand und einem moralische Unterstützung gab, wenn man mal wieder sprachlich fragwürdige Nullsätze in den Laptop tippte. Hatte Steinmeier ihr die Auszeichnung verliehen, weil er und sie sich so ähnlich waren?
Juli schlenderte über den Dorfanger. Ihr Mann August und die Kinder September und Oktober wollten erst später nachkommen. Gentrifizow war ein altes brandenburgisches Dorf. Die Ureinwohner waren mit der Zeit nach Berlin abgewandert oder zum Sterben in den Wald gegangen und hatten zivilisationsmüden Künstlern aus der Stadt Platz gemacht. Gentrifizow bestand im Grunde nur noch aus zwei großbäuerlichen Familien, einer Handvoll alter Leute und dem obligatorischen Dorftrottel. Darüberhinaus wohnten hier ausschließlich talentlose Schriftsteller, die von Berlin aufs Land gezogen waren, damit die Kinder nicht mit den vielen Ausländern in die Schule mussten. Kürzlich war sogar die Literaturnobelpreis-Anwärterin Charlotte Roche hinzugekommen.
Die früher üblichen Sonnwendfeste, das Ostereiertrudeln und das wöchentliche Zigeunerklatschen waren mit den alten Bewohnern verschwunden. Dafür hatten die neuen Einwohner eine eigene Tradition gestiftet: das Stilblütenfest. Es fand nun schon zum achten Mal statt. Auf dem Anger wurde gegrillt, man las sich gegenseitig aus seinen Büchern vor, es gab Buchstabensuppe und jeder brachte einen Metaphernsalat mit – Juli selbstverständlich den größten.
Wie ein Marschflugkörper schoss Juli auf eine Gruppe Schriftstellerinnen und Schriftsteller zu. »Hallo alle miteinander!«, sagte sie. Jeder, der mit Juli sprach, merkte sofort, dass sie Juristin war. Sie sprach druckreif. Oder zumindest so, dass ihr Verleger es für druckreif hielt. Die Gruppe unterhielt sich gerade über Politik. »Bist du nicht in der FDP?«, fragte ein Lyriker, der genau so aussah, wie Juli Zeh sich einen Lyriker vorstellte. »Nein, nein«, sagte Juli. »Während der Schulz-Hysterie Anfang 2017 bin ich in die SPD eingetreten.« Keiner lachte, alle nickten verständnisvoll. »Die Europabegeisterung, die Schulz vermitteln konnte, war ansteckend wie Chlamydien in einem vollbesetzten Bus«, schwärmte sie. »Gewählt habe ich natürlich trotzdem die Merkel.« Wieder nickten alle.
»Es wäre schön, wenn du uns was aus deinem neuen Buch vorlesen könntest«, log der Lyriker. »Gerne«, sagte Juli und zitierte aus »Leere Herzen«, ihrem aktuellen Roman: »Danach wirbelte sie Vera durch die Luft, genoss ihr glückliches Kreischen und die ›Mama-Mama‹-Rufe und umarmte Richard ein weiteres Mal. Seine aufgerissenen Augen waren wie Etiketten auf einem großen Sack voller Fragen.« – »Wunderschön! Ich sehe es direkt vor mir«, sagte der Lyriker. Juli kam es vor, als sei er bei diesen Worten kleiner geworden. Von wegen Lügen und kurze Beine und so. In Momenten wie diesen, in denen sie in ihrer Romanwelt lebte, fragte sie sich manchmal, ob sie nicht eine gute Anwältin geworden wäre.
Das Bundesverdienstkreuz in ihrer Tasche erinnerte sie jedoch daran, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hatte. Auch wenn die Romanwelt oft verwirrend war und ihr sinnlos erschien. Jetzt zum Beispiel tat der Lyriker, was auch ihre Romanfiguren taten: Er blickte sie an, als hätte er versucht, etwas zu stehlen, das ihm nicht gehörte. Das war krass. Wenn auch nicht ganz so verstörend wie der leere Blick von jemandem, der versucht, etwas zu stehlen, das ihm gehört.
Juli sah hinüber zur alten Kirche. Jemand musste mittlerweile den Wind erfunden und eingeschaltet haben. Die Baumwipfel bewegten sich bitter wie ein kleiner Sack voller Unvermögen.
Und nirgendwo krähte ein Hahn.
Gregor Füller
Zeichnung: Frank Hoppman